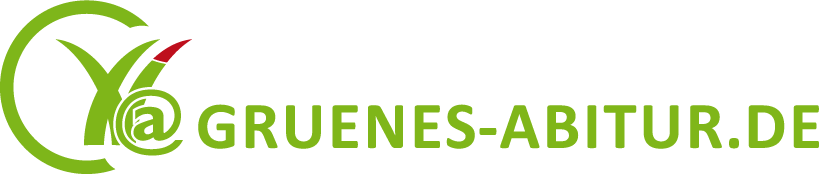Wärmebildtechnik kurz erklärt

Die Funktionsweise einer Wärmebildkamera
Wärmebildkameras verarbeiten die für Menschen unsichtbare Infrarotstrahlung elektronisch. Das Microbolometer ist das Bauteil in der Wärmebildkamera, welches die IR Strahlung aufnimmt und umgewandelt weitergibt. Die weitere Elektronik rechnet diese Signale in ein Bild um. Aktuelle Microbolometer lösen Temperaturunterschiede von bis zu 0,05° Kelvin (bzw. Celsius) auf.
Die Unterschiede bei Microbolometer-Sensoren
In den aktuell zivil erhältlichen Wärmebildkameras sind ungekühlte Microbolometer verbaut. Ungekühlte Microbolometer-Sensoren sind entweder aus amorphem Silizium (a-Si) oder aus Vanadium Oxid (VOx) gefertigt.
A-Si-Sensoren sind in der Herstellung günstiger, dafür bieten VOx-Sensoren mit einer besseren Bildqualität auf.
Die Kalibrierung bei Wärmebildkameras
In der Anwendung stellt das von der Wärmebildkamera generierte Bild immer die in dem jeweils aktuellen Bildausschnitt vorhandenen Temperaturunterschiede dar. Je größer Temperaturunterschiede sind, desto größer ist auch der auf dem Bildschirm dargestellte Hell-Dunkel-Kontrast.
Sie Sensoren des Microbolometers werden im Gebrauch mit der Zeit unempfindlicher, das Bild wird unausgewogen. Daher muss der Sensor regelmäßig kalibriert werden. Das geschieht automatisch oder per Knopfdruck und das Gerät meldet sich nach einem kurzen Standbildmoment wieder mit einem kontraststarkem Bild zurück.
Das Schliessen der Blende zum Kalibrieren ist in der Regel, je nach Modell, mit einem leisen Klicken oder Sirren verbunden, was aber vom Wild in der Jagdpraxis auch auf kurze Entfernung nicht wahrgenommen wird.
Die Sensorauflösungen von Wärmebildkameras
Die Sensorauflösung hat einen Einfluss auf den darstellbaren Detailgrad. Je Höher die Auflösung des Microbolometer-Sensors ist, desto detailreicher ist das Bild. Das bedeutet im Nahbereich mehr sichtbare Bilddetails und ein besseres Erkennen von Wild auf Entfernungen bis zu 1,5 Kilometer.
Folgende Pixel-Auflösungen sind aktuell (2019) gängig im Markt:
- 160x120 - 0,02 Megapixel - Einsteigerklasse zum Detektieren von Wild
- 240x180 - 0,04 Megapixel - Mittelklasse zum Identifizieren auf kürzere Distanzen
- 320x240 - 0,08 Megapixel - Oberklasse zum Identifizieren bis mittlere Distanzen
- 640x480 - 0,31 Megapixel - Profiklasse zum Ansprechen bis mittlere Distanzen
Die Pixelgröße von Microbolometer-Sensoren in µm (Pitch)
Die Detektorzellengröße wird in Mikrometer (µm) im Quadrat gemessen. Je kleiner das einzelne Sensor-Pixel ist, desto schärfer und kontrastreicher kann das Bild sein. Die Pixelgröße beeinflusst auch die notwendigen Größen des Linsensystems etc.. D.h. mit kleineren Sensor-Pixeln kann sind bei gleicher Auflösung kompaktere Wärmebildkameras möglich.
Die aktuellen Sensoren haben einen Pitch zwischen 25 und 12 µm.
Die Bildfrequenz von Wärmebildkameras
Die Bildwiederholrate bestimmt, wie flüssig und sauber das Bewegtbild beim Schwenken über den Bildschirm läuft. Es sind aktuell folgende Bildfrequenzen üblich:
- 9 Hz - deutlich ruckelndes Bild bei Schwenks
- 25/30 Hz - flüssiges Bewegtbild, ggf. mit Bewegungsunschärfe bei schnellen Schwenks
- 50 Hz - Flüssiges Bewegtbild, auch bei schnellen Schwenks
Die Bildfrequenzen in Kino oder Fernsehen liegt bei 24 bis 25 Bildern pro Sekunde.
Die Brennweiten bei Wärmebildkameras
Wie bei Objektiven für Fotokameras werden Wärmebildkameras in verschiedenen Festbrennweiten angeboten. Von Weitwinkelobjektiven bis zum leichten Teleobjektiv. Durch die verschiedenen Sensorgrößen entsprechen die effektiven Brennweiten nicht immer den nominalen Brennweiten.
Die Wahl der Brennweite hängt vom Einsatzgebiet ab. Weitwinkel-Brennweiten unter 19mm sind eher für Waldreviere mit vergleichsweise kurzen Reichweiten geeignet. Die 30er Brennweiten sind ein ideal für ein ausgeglichenes Feld-Wald-Revier. Die 50er Brennweiten eignen sich eher für Reviere mittleren bis weiten Detektionsdistanzen.
Aktuelle Wärmebildkameras werden in verschiedenen Festbrennweiten angeboten. Folgende Brennweitenbereiche sind aktuell üblich:
- 13/18/19 mm - kurze Reichweite, breites Sichtfeld auf 100m
- 35/38 mm - mittlere Reichweite, mittleres Sichtfeld auf 100m
- 50 mm - weite Reichweite, enges Sichtfeld auf 100m
Der Zoom bei Wärmebildkameras
Die aktuell gängigen Wärmebildkameras am Markt haben eine feste Brennweite. Die angegebenen Zoomfaktoren sind also reine Digitalzooms. D.h. hier wird nur aus dem bestehenden Bildsignal ein Ausschnitt dargestellt. Dieser Ausschnitt ist unschärfer bzw. verpixelter, da sich sich weder das ankommende Infrarotsignal noch die Sensorauflösung ändern. Der Digitalzoom ist bei den aktuell gängigen Sensorauflösungen von max. 0,3 Megapixel nur geeignet, um sich auf einen Bildausschnitt zu konzentrieren.
Bildmodi einer Wärmebildkamera
Die vom Microbolometer empfangenen Infrarotsignale werden elektronisch weiterverarbeitet und anschliessend auf einem Display als Bilder wiedergegeben. Die Software, die die Signale umwandelt kann die Bilder für den Betrachter je nach Anwendung in verschiedenen Modi ausgeben:
- Red-Alert - farbige Darstellung der Temperaturbereiche. z.B. von rot (warm) zu blau (kalt). So ist eine differenziertere Temperaturbestimmung möglich.
- Black-Hot - warm ist schwarz, kalt ist weiß dargestellt. Die Abstufungen dazwischen in Graustufen
- White-Hot - warm wird weiß, kalt schwarz dargestellt. Die Abstufungen dazwischen in Graustufen - ideal für die Jagd